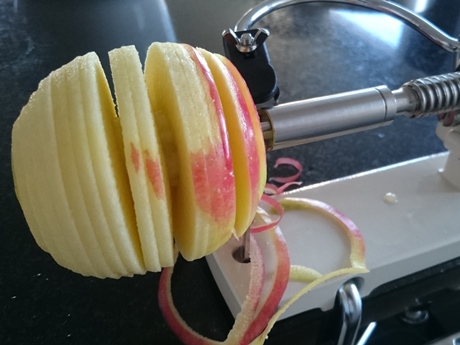Die Rösti – kulinarisches, schweizerisches Hoheitsgebiet. Der „Tages-Anzeiger“ ging vor einiger Zeit der Frage auf den Grund, wie man sie perfekt hinbekommt. Vier Restaurants, die er besuchte und die für ihren Kartoffelfladen weit herum bekannt sind, gaben ihr Rezept preis. Die Erkenntnis: es führen etwa so viele Wege zur perfekten Rösti wie nach Rom. Die Konsequenz: jeder, der sie selber brät, muss seinen eigenen Weg finden.
Manche der befragten Restaurateure nehmen festkochende, andere schwören auf mehligkochende Kartoffeln, die einen braten sie gleich im rohen Zustand an, die anderen im gekochten, und zwar in Öl, Schweineschmalz oder Butter. In den geriebenen Kartoffeln in der Bratpfanne zuerst noch rühren oder auch keinesfalls mehr berühren, einen Deckel auf die Pfanne legen oder ihn meiden wie der Teufel das Weihwasser – der pure Wildwuchs. Die verschiedenen Arten der Röstizubereitung gleichen einem Glaubensbekenntnis.
So etwas wie ein Originalrezept für Rösti? Fehlanzeige. Die Website „Kulinarisches Erbe der Schweiz“ verbrennt sich denn bei diesem Gericht auch nicht ihre Finger an der Bratpfanne: den Begriff „Rösti“ findet man ob solch ausufernder Rezept-Opulenz nicht einmal.
Also geht’s unter dem Strich eigentlich nur um die Frage: Was macht die perfekte Rösti aus, wie muss sie sein? Schmackhaft natürlich, beidseits schön goldbraun gebraten, aussen knusprig und innen gar, kein Kartoffelmus, aber auch nicht Kartoffelstäbchen, die kaum zusammenhalten. Zumindest ist dies mein Verständnis einer guten Rösti. Wie ich im Verlaufe der Jahre meinen Weg dahin verfeinert habe, sei hier verraten.
- Man nehme: die richtige Kartoffel
In den Supermärkten sind die Kartoffeln meist farbcodiert: blau = mehligkochend, enthält viel Stärke; grün = festkochend, enthält wenig Stärke; rot = vorwiegend festkochend, die goldene Mitte. Die soll’s sein, und auf den entsprechenden Beuteln ist ihr Einsatz für Rösti denn auch meist explizit erwähnt. Bei mehligkochenden Kartoffeln besteht die Gefahr, dass sie zu Brei zerfallen, bei festkochenden verbinden sich die geriebenen Kartoffeln zu wenig.
- Schonend gegart
Für mich nur noch gekocht, ausser es eilt. Aber nicht irgendwie gekocht, sondern sozusagen schonend gegart. Die Beobachtung, die dem zugrunde liegt: kocht man Kartoffeln auf der höchsten Stufe, so kann die Schale aussen abplatzen, der Randbereich ist pflotschig, innen aber unter Umständen noch zu roh. Was aber wäre optimal? Eine Kartoffel, die durchgehend gleich gar ist. So kam ich auf die Idee, das, was für Roastbeef gilt, auf die Knolle zu übertragen: langsam bei tiefer Temperatur garen. Vorgehen: Kartoffeln ins Salzwasser, den Topfinhalt bei höchster Stufe erhitzen bis es blubbert (sonst dauert es zu lange), ca. 1 Minute kochen lassen, dann auf die niedrigste Stufe, Deckel drauf – da blubbert’s nach kurzer Zeit nicht mal mehr. Jetzt so lange garen, bis die Kartoffeln beim Reinstechen mit dem Messer immer noch gut Widerstand leisten (je nach Grösse der Kartoffeln zwischen 10 und 30 Minuten). Oftmals wird erwähnt, dass die Kartoffeln am Vortag gekocht werden müssen. Meines Erachtens unnötig. Komplett ausgekühlt soll sie sein, wenn sie nach dem Schälen an der Grobreibe gerieben werden, aber dazu reichen ein paar Stunden.
- Die beste Pfanne
Mit einer Bratpfanne mit Beschichtung funktioniert’s am besten, alles andere ist Nostalgie. Gusseisenpfannen sind zwar das Traditionsgerät und unkaputtbar, aber Gebratenes löst sich hier einfach weniger leicht als von einer beschichteten Bratpfanne.
- Öl, Butter oder Schweineschmalz
Ansichtssache, aber für mich muss es Butter sein, am einfachsten Bratbutter. Auch mit normaler Butter geht’s: gibt man gleich nach dem Schmelzen die geriebenen Kartoffeln in die Pfanne, saugen diese die Butter sofort auf und sie wird – auch dank der nicht zu hohen Brattemperatur – nicht schwarz.
- Brathitze
Die besten Erfahrungen mit einer gleichmässigen goldbraunen Färbung habe ich mit 2/3 Hitze gemacht, also ca. Stufe 6 von 9.
- Kein Deckel, nicht umrühren
Butter in die Pfanne, schmelzen lassen, Kartoffeln rein, Kuchen formen. Und jetzt Finger weg! Und zwar je nach Herd und verwendeter Pfanne für 10 bis 20 Minuten.
- Wenden
Früher habe ich es mit dem schwungvollen Wenden in der Luft probiert. Hat manchmal bestens geklappt, manchmal etwas weniger. Am einfachsten geht es mit einem Silikondeckel, der extra fürs Wenden gemacht wurde: passt auf verschiedene Pfannengrössen, ist schön flutschig, hat keinen Rand. Ebenfalls tauglich: die Unterseite eines runden Backblechs, flache Deckel oder Teller. Also: Deckel drauf, Pfanne wenden, Rösti kurz beiseite stellen, nochmals Butter rein, Rösti am Stück in die Bratpfanne gleiten lassen, andere Seite braten. Fertig.